Maurizio Piro: Seraphenreigen
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Florian Birnmeyer
Maurizio Piro: Seraphenreigen. Berlin (Verlag der 9 Reiche) 2025. 32 Seiten. 9,00 Euro.
Es gibt junge Stimmen, die sofort einen eigenen
Ton anschlagen. Maurizio Piro, Jahrgang 2001, gehört zu ihnen. Preise hat er
schon früh gewonnen – 2019 den Wettbewerb Spuren Schreiben,
2025 den Hanns-Meinke-Preis. Aber das Beeindruckende an seiner Dichtung ist
weniger die äußere Anerkennung als die innere Konsequenz: Piro schreibt eine
Lyrik, die auf sich selbst vertraut, die Schönheit nicht als dekoratives
Beiwerk, sondern als Form des Widerstands begreift. Gegen die Welt, gegen das
Banale, gegen die Zumutungen des Alltags. Es ist eine Sprache, die sich nicht
rechtfertigt, die sich nicht erklären muss. Sie steht da, eigensinnig, fast
trotzig – und darin liegt ihre Kraft.
Man könnte sagen, Piros Gedichte folgen der Linie
Mallarmés: l’art pour l’art. Doch dieser
Vergleich, so naheliegend er scheint, greift auch zu kurz. Denn die Texte
verweigern zwar das Zielgerichtete, das Funktionale, sie verzichten auf
Botschaft, Moral oder eindeutige Deutung. Aber gerade darin, in dieser
Weigerung, liegt eine eigentümliche Behauptung. Zwischen Titel und Text klafft
oft ein Abstand: Die Gedichte heißen Atlas, Narziss,
Orpheus und Eurydike – und erzählen doch nichts, was
den antiken Stoff „nacherzählt“. Vielmehr schwingen sie mit, vergegenwärtigen
Mythen im Klang, in der Bewegung, in der Form. Sie entwickeln ein Eigenleben,
das den Leserinnen und Lesern entgleitet, ohne sie abzuweisen.
Der Band Seraphenreigen,
erschienen in der Reihe Lyrik Edition Neun, gliedert
sich in drei Teile. Alle drei eint die Sorgfalt: Man spürt, wie hier an der
Sprache gefeilt wurde. Die Gedichte sind stark verdichtet, Verben, Substantive,
Adjektive greifen wie Zahnräder ineinander. Rhythmus, Melodie, Form – nichts
wirkt beiläufig. Es ist eine Kunst der Balance, die nicht ausufern will,
sondern sich kontrolliert entfaltet.
Besonders eindrücklich ist der erste Teil, Faunische
Tage. Er bringt eine bukolische, fast arkadische Stimmung ins
Spiel, in der Naturbilder und mythologische Anklänge miteinander verschmelzen.
Da ist ein Ton, der zwischen antiker Verson-nenheit und modernem Ästhetizismus
schwebt. Verse wie diese bleiben hängen:
Sie stürzen über wilde Thymianteppiche,Durch ungeheure gelbe Gärten, goldne Seen.Darin sich Ranken in verliebten Kreisen knüpfen,Wie Bronzespangen um die Arme schöner Tänzer.(Die Toteninsel, S. 6)
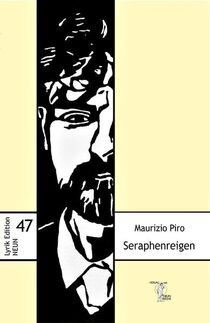
Es sind Verse, die hängen bleiben, die
nachhallen, weil sie aus der Zeit gefallen scheinen.
Der Titel des Bandes verweist auf ein
Ineinandergreifen: Seraphenreigen – ein Tanz,
bei dem sich die Gedichte an den Händen fassen. Dieses Prinzip trägt durch alle
drei Teile. Der zweite Teil bringt die titelgebenden Engel ins Spiel, die
Seraphen. Sie erscheinen in einem religiös-mystischen Kontext, begleitet von
hebräischen Verszitaten, die Piro den Gedichten zur Seite stellt. Diese
Einfügungen sind mehr als bloße Paratexte: Sie schaffen eine zusätzliche Ebene,
einen Dialog zwischen Tradition und lyrischer Gegenwart.
Im dritten Teil schließlich, Der
blaue Baldachin, begegnet man den poetischen Ahnen. Gedichte an
Hugo von Hofmannsthal, Marcel Proust, Georg Heym, Rainer Maria Rilke. Hier
zeigt sich Piros literarische Herkunft, seine Bewunderung für das Vergangene.
Diese Reverenzen sind konsequent, und zugleich riskant. Denn Piro orientiert
sich in seinem Gedichtband in Gestus und Tonfall an der Vergangenheit, ähnlich
wie viele andere Bände der Reihe Lyrik Edition Neun. Die Kunst besteht jedoch darin,
die Tradition nicht nur zu zitieren, sondern durch die eigene Gegenwart
hindurch strahlen zu lassen und so zu transzendieren.
Trotzdem: Was bleibt, ist der Eindruck einer
Stimme, die sich behauptet. Seraphenreigen ist ein Band,
der nicht gefallen will, sondern bestehen. Piros Gedichte entfalten eine
Schönheit, die widerständig ist, die sich der Nützlichkeit entzieht. Und
vielleicht ist genau das ihr größter Wert: dass sie uns erinnern, dass Dichtung
nicht erklären, nicht rechtfertigen, nicht belehren muss – sondern dass sie da
ist, wie ein Lichtstrahl, wie ein Klang, wie ein Tanz.
Von dieser Lyrik, von dieser Stimme wird man noch
hören.


