Martina Hefter: Eine Nachbemerkung
Diskurs/Kommentare > Diskurse > Kommentare
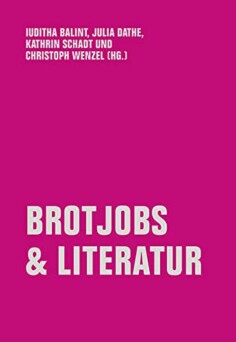
Martina Hefter
Eine Nachbemerkung
Zu meinem Text über die Brotjobs bekam ich einige mehr oder weniger aggressive PNs über Facebook (aber auch ein paar schöne, verstehende Mails und Nachrichten, für die ich mich nochmal sehr bedanke). Ich wollte mich keinesfalls über Menschen mit einem “Brotjob” erheben - egal, ob sie zusätzlich einer künstlerischen Arbeit nachgehen oder nicht. Aber vielleicht habe ich meine Arbeit nicht gewissenhaft genug gemacht und den Text ungenau geschrieben.
Also nochmal von vorn (wenn ich “Künstler*in” schreibe, meine ich alle Sparten).
Zufällig las ich ein paar Tage vorher, auch auf Facebook, den Post eines Radiosenders (ich habe vergessen, welcher), der über eine bildende Künstlerin berichtete, die öffentlich etwas Ähnliches sagte wie ich, nämlich, dass sie in ihrem Beruf arbeiten wolle und nicht noch zusätzlich in einem anderen. Es gab aggressive, wütende und verletzende Kommentare unter dem Beitrag, ich habe nur die ersten zwanzig gelesen. Der Künstlerin wurde Arroganz und Hochmut unterstellt. Manche sagten, sie solle was Richtiges arbeiten, dann würde sie schon runterkommen von ihrem hohen Ross. Einer schrieb, es sei schade, dass es keine Arbeitslager mehr gebe.
Ich frage mich, nicht zum ersten Mal, was bei manchen Leuten diese Aggression auslöst, wenn Künstler*innen sagen, sie möchten gern in ihrem Beruf arbeiten. Oder dass sie ihren Beruf gerne ausüben. Wenn sie sagen, dass sie ein Auskommen hätten, das ganz okay ist. Wenn sie sich nicht von vornherein in die Rolle fügen, die anscheinend die einzige ist, die man ihnen ohne Widerspruch zugesteht: Die Rolle des verarmten, zerquälten Künstlermenschen.
Denen, die ganz offensichtlich sehr viel Geld mit der Kunst verdienen, lässt man ihren Wunsch zwar durchgehen, bzw. hinterfragt man ihn nicht groß, denn sie sind ja erfolgreich. Aber dass sie glücklich und zufrieden sind, das darf dann bitte auch nicht sein - berühmten, gut verdienenden, erfolgreichen Künstler*innen werden ja immer mindestens Neurosen, Unglück, Sauferei, Egoismus und Menschenhass angehängt. Den anderen, die nicht so bekannt oder berühmt sind, leider auch manchmal.
Das kommt vielleicht davon, dass der Geniegedanke immer noch so sehr präsent in unserer Gesellschaft ist. Und damit ein merkwürdiges Bild davon, was man so tut als Künstler*in. Wobei ich sagen muss, dass ich vielen Menschen begegne, die das nicht haben, die es realistisch sehen, und das sind keineswegs nur andere Künstler*innen.
Es gibt ein tolles Buch, ein Kunstbuch, das den ganz profanen, wunderschönen, abwechslungs-reichen Arbeitsalltag einer (in diesem Fall: bildenden) Künstlerin ziemlich gut erfahrbar abbildet: “VOR” der Leipziger Künstlerin Bea Meyer. Das Buch besteht aus einer kompletten Abschrift von Meyers Kalendern der Jahre 2000 bis 2015. Da stehen nur sehr selten tagebuchartige Betrachtungen drin. Sondern hauptsächlich Termine in der Druckerei. Termine in einer Weberei. Termine beim Physiotherapeuten. Babyschwimmen, Geburtstage, Ausstellungseröffnungen, ein Treffen mit “Frau Kunze”, eine Erinnerung, die lautet: “alle 3 aufspannen”. Oder: “Szillo-Zeug Edition b2 abholen E-Milch PAPIER mitn.” Bea Meyer kann übrigens von ihrer Arbeit leben, ohne weltberühmt zu sein. Sie gewinnt manchmal Ausschreibungen für Kunst am Bau oder bei anderen Wettbewerben (völlig verdient) und stellt auch schon mal in großen Museen aus. Vom Verkauf ihrer Arbeiten allein kann sie nicht leben, aber das muss ja auch gar nicht sein. Bea Meyer hat drei Töchter und einen Mann, der auch freiberuflich in der Kunst unterwegs ist.
Am besten, ich liste auch mal einen Arbeitstag auf (es sieht aber jeder Tag anders aus): Gestern habe ich den Vormittag mit telefonieren verbracht. Zuerst mit dem Leiter der Spielstätte, in der mein nächstes “Stück” gezeigt wird, ich mache aus dem Linn Meier-Text in meinem letzten Buch eine Art Dance-Musik-Show. Wir haben die Spieltermine und einen zusätzlichen Auftritt in einer zweiten Spielstätte abgesprochen und Details über die Räumlichkeiten diskutiert. Und einiges mehr. Dann habe ich bei der Ostdeutschen Sparkassenstiftung angerufen wegen einer weiteren Fördermöglichkeit neben dem, was ich schon bekomme oder noch beantragen werde. Der Mann am Telefon beriet mich ausführlich und lange, mit dem Ergebnis, dass mein Projekt für die Stiftung zu klein ist von der Antragssumme her (für mich ist es schon ziemlich groß), und gab mir die Telefonnummer des zuständigen Mitarbeiters der Sparkasse Leipzig, Abteilung Sponsoring und Spenden. Mit dem habe ich auch nochmal gut eine halbe Stunde gesprochen. Früher fand ich solche Förderangelegenheiten anstrengend und nervig, aber je länger ich diese Arbeit mache, desto mehr gefallen mir auch diese Aspekte meines Berufs. Ich finde es nicht schlecht, einen Finanzplan aufstellen zu können, und wenn die Summen größer sind, umso interessanter. An meinen Texten gearbeitet habe ich gestern gar nicht, es gab noch Tanztraining, E-Mails, was ausprobieren für ein Projekt mit der Residenz vom Schauspiel Leipzig, das Ende März stattfindet (gut bezahlt). Texte geschrieben habe ich erst am nächsten Morgen. Eines wird mir nach so einem Tag wieder sehr klar: Dass es mich sicher überfordern würde, zusätzlich noch beim Lukas-Bäcker hinter der Theke zu stehen o.ä.. Folgendes ist weder Arroganz noch aus einem deutschen Arbeitsethos heraus gesagt: Ich strenge mich (in einem für mich positiven Sinn) schon an damit, meine Arbeit so zu machen, damit ich sie auch weitermachen kann. Weil ich eben nicht zum Lukas-Bäcker will, und auch nicht kann. Heißt: Ich möchte meine Arbeit so machen, dass Leute vielleicht jedesmal wieder neugierig drauf sind. Dass sie sie vielleicht sogar erfreut. Oder von mir aus auch erzürnt. Jedenfalls ihnen etwas gibt, etwas, das auf seine Weise immateriell ist (wenn man von den Trägermaterialien absieht, Papier oder Bühnenraum). Aber eben trotzdem in irgendeiner Weise bereichernd.
Und das, unter anderem, macht mir eben sehr große Freude.
Ich glaube, das kann man schon sagen, ohne dass einem gleich aggressive Nachrichten geschickt werden, die besagen, ich würde auf arbeitende Leute herabsehen. Das tu ich nicht, ich arbeite ja selber. Ich nehme mit meiner Arbeit auch niemand anderem was weg.
Zu guter Letzt: Gerade betreue ich eine Studentin von der Kunsthochschule in ihrer Abschlussarbeit. Das ist nicht Teil meines Workshops, den ich dort im Herbst leitete, sondern die Studentin kam von sich aus auf mich zu mit der Frage nach Austausch/Begleitung. Das mache ich gern (im Rahmen meiner Möglichkeiten), und zwar logischerweise umsonst. Ich empfinde das auch als Teil meines Berufes, und als Selbstverständlichkeit: dass ich Erfahrungen weitergebe und teile mit Leuten, die eher noch am Anfang des Berufs stehen. Demgegenüber lehne ich Anfragen von Einzelpersonen nach bezahlten Schreibcoachings eigentlich immer ab. Das würde mich zu sehr in seltsame Verpflichtungszusammenhänge bringen. Geld verdiene ich ja schon mit anderen Sachen. Jedenfalls macht mich die Zusammenarbeit mit der Studentin gerade auch wieder glücklich. Und einige andere, die sich anbahnen, oder fortbestehen, auch. Und das ganz ohne einen Gedanken an Geld.


