Martin Andersson: Gestrandete Satanisten
Diskurs/Kommentare > Diskurse
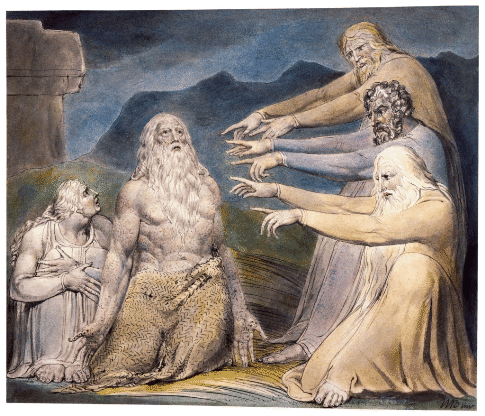
Martin Andersson:
Gestrandete Satanisten
Aus Kopf wird Zahl. Alles ist eine Sache der Perspektive. Alles
subjektiv. Alles konstruiert. Wir können so, aber auch anders.
Und doch immer
dasselbe. Wir könnten Satanisten sein und sind es nicht. Natürlich gibt es die Church
of Satan, längst eingetragen, Black Metal existiert an sich nicht ohne
Satanismus und die eigentlich okkultistische Tradition schwelt wahrscheinlich
auch in ihrer dünnen, niemals so richtig platzenden Blase weiter. Der gebildete
Leser kennt auch „Satana“ aus dem Zauberberg, wo der
Aufklärungsrepräsentant Settembrini einmal so angesprochen wird (welch
Pfeffer!). Die Figur lehnt sich an einen „Radikalen“ des 19. Jahrhunderts,
Giosuè Carducci an, der in seiner Hymne an Satan, den Sieg Satans mit
dem der Vernunft gleichsetzt. Man vergleiche damit jemanden, der sich über
diesen Triumph des Positivismus schon erhaben weiß: den okkultistischen
Beineberg in Musils Verwirrungen des Zöglings Törleß. „Siehst du, man behauptet, die
Welt bestünde aus mechanischen Gesetzen, an denen sich nicht rütteln lasse. Das
ist ganz falsch, das steht nur in den Schulbüchern!“ Aber auch
die scheinbare Subversion der Vernunft planscht im selben Becken. Bald hat es
Beineberg auf den positiven Beweis durch das Experiment abgesehen; bloß muss es
in einer verborgenen Dachkammer, getaucht in die unheimliche Bläue einer
Spiritusflamme, geschehen. Der moderne Okkultist, umgedrehter Positivist, bannt
keine Geister, sondern praktiziert eine Mechanik des Unsichtbaren – die „Kraft“
der neuzeitlichen Physik, nur mit der Geste gerade ein Karnickel aus dem Hut zu
ziehen.
Und das ist möglich.
Eigentlich sollte es nicht möglich sein, laut unserer Eingangs-hypothese, dass
sich etwas als unmöglich erweist. Alles eine Sache der Perspektive. Alles
schon, aber nichts Einzelnes. Jede einzelne Sache weiß sich Geltung zu
verschaffen, jede Insel des Diskurses bannt uns als notwendige Landtreter in
ihre festen Konturen. Und doch ist alles eine Sache der Perspektive, versichern
wir uns ständig.
Wirkliche Erschaffung des Teufels. Jeder sagt, dass es keine Fakten
gibt ohne Interpretation. Weniger bekannt und doch genauso wichtig ist, dass es
keine Interpretation gibt ohne Fakten. Laut Althistoriker Paul Veyne sind die
Griechen stets davon ausgegangen, dass irgendwo am Boden des Wortes auch die
Sache stecken muss. Die griechische Philosophie kommt nicht auf die Idee, die
Götter abzuschaffen: sie müssen nur richtig interpretiert werden, selbst in
materialistischen Lehren. Am weitesten gingen noch diejenigen, die in ihnen
lehrreiche Allegorien sehen wollten. Sie haben mit der Etymologie das etymon
gesucht, die wahre Bedeutung eines Wortes.
Wer würde diesen
Griechen heute noch rechtgeben? Da unsere Zeit in die Vollendung der Metaphysik
geschickt ist, wird ein Hören auf die Sprache oft zurückgewiesen, weil alles,
was kein Machwerk („Konstruktion“) eines Subjekts ist, von vornherein als
unmöglich gilt, dergleichen vorzuschlagen ist bestenfalls exzentrisch, eine
Zumutung, und wird in der Tat nicht durch Argumente widerlegt, sondern indem
die betreffende These als – genau – Machwerk eines Subjekts erwiesen wird, z.B.
eine so genannte „Projektion“. Es gilt sodann als ausgemacht, dass die Sprache
auf „menschlichem Setzen (thesis)“ beruht, weil die einzige geläufige
Gegenposition davon ausgeht, ausginge, dass die Wörter die Sachen „abbilden“.
Obwohl jeder weiß, dass sogar die Hunde in verschiedenen Sprachen verschieden
bellen.
Schon Platon hat es im Kratylos
falsch gemacht: „Um nur das berühmteste Beispiel zu erwähnen (das durch die
gesamte sprachphilosophische Literatur geistert): Hermogenes muß zugestehen,
daß das [r] im griechischen Wort rhein ein Fließen abbildet (426c) oder
daß soma ,Körperʻ und sema ,Zeichen, Grabʻ miteinander verbunden
seien, weil die Körper Zeichen und Gräber der Seele seien (400b/c).“ Der
Gegenwartsmensch, der die „Arbitrarität“ der Zeichen mit fließender Geste zur
Arbitrarität aller Dinge macht, wird heimgesucht vom bösen Heidegger (wie kommt
er dazu!), ja der hat „dieses wilde ,etymologischeʻ Denken aus Sprache heraus
wieder hoffähig gemacht, obwohl er es eigentlich besser wissen müßte.“
Wir haben hier das Buch des
Romanisten Jürgen Trabant Mithridates im Paradies. Eine kleine Geschichte
des Sprachdenkens stellvertretend für die moderne thesei-Metaphysik der
Sprache zitiert. In der Tat werden etymologische Wortgeschichten von Heidegger
gar nicht selten in Anspruch genommen. Etwa die folgende: „Wirkenʻ gehört zum
indogermanischen Stamm uerg, daher unser Wort ,Werkʻ und das griechische ἕργον.“ Nun wird das Wort bereits vor seiner philosophischen Prägung durch
Aristoteles eine Bedeutung gehabt haben, an welche der Philosoph anschließen
musste oder nolens volens anschloss. Über die lateinische Übersetzung als actio
wird die Wirklichkeit zum Verursachten, zu dem, was die Wissenschaft kausal
erklären kann, sodass der Wandel im Gebrauch verständlich wird: „Daß nun
aber das Wort ,wirklichʽ mit dem Beginn der Neuzeit, seit dem 17. Jahrhundert,
so viel bedeutet wie ,gewißʽ, ist weder ein Zufall, noch eine harmlose Laune
des Bedeutungswandels bloßer Wörter.“ (Die neuzeitliche Wissenschaft will sich
der Ständigkeit ihres Gegenstandes versichern). Demgegenüber hatte Heidegger
zuvor erklärt, dass „in der Sprache des Mittelalters“ (dass sich unter anderem
dadurch als eigene Epoche abhebt) „wirken“ die Bedeutung von „Hervorbringen von
Häusern, Geräten, Bildern“ gehabt hatte; ein Hervorbringen nennt er auch das
„nähen, sticken, weben“ (wo also auch heute ein verstaubter, aber noch
möglicher Gebrauch sagt „Stoffe wirken“).
Der Aufweis der
Geschichtlichkeit des Gebrauchs ist genau das, was ihn öffnet, was neue
Ausfaltungen ermöglicht. Sein Verständnis von Etymologie erklärt Heidegger
folgendermaßen: „Das bloße Feststellen der alten und oft nicht mehr sprechenden
Bedeutung der Wörter, das Aufgreifen dieser Bedeutung in der Absicht, sie in
einem neuen Sprachgebrauch zu verwenden, führt zu nichts, es sei denn zur
Willkür. Es gilt vielmehr, im Anhalt an die frühe Wortbedeutung und ihren
Wandel den Sachbereich zu erblicken, in den das Wort hineinspricht. Es gilt,
diesen Wesensbereich als denjenigen zu bedenken, innerhalb dessen sich die
durch das Wort genannte Sache bewegt. Nur so spricht das Wort und zwar im
Zusammenhang der Bedeutungen, in die sich die von ihm genannte Sache durch die
Geschichte des Denkens und Dichtens hindurch entfaltet.“
Wir müssten also gar
keine gescheiterten Satanisten sein, denn nach dieser Theorie existiert der
Satan durchaus. Sein Ursprung liegt im alten Iran, in der Offenbarung Zarathustras.
Sind historische
Mythologien allgemein geprägt vom Kampf den Menschen gutgesinnter Gottheiten
gegen aus dem Meer kommende Chaosmonster – Indra gegen Vritra, Thor gegen die
Midgardschlange, Baʼal gegen Yam – so macht der zoroastrische Dualismus den
Kampf von Ordnung und Chaos zum Grundprinzip. Wer rechtlich und ehrlich lebt,
der hilft dem guten Schöpfergott Ahura Mazda im Ringen mit seinem bösen
Gegenspieler Angra Mainyu. Bei der Schaffung ihres großen Reiches machten die
Perser auch die Juden zu einem imperialen Baustein, und --- so faszinierend die
Geschichte der jüdischen Apokalypsen, die nun ihren Lauf nimmt, auch ist, hier
nur so viel: der böse Gott Irans wird mit „Satan“ identifiziert, im Alten
Testament noch ein angesehener Funktionär am Hofe des einen Gottes, bald aber
der Vorläufer des christlichen Teufels und des islamischen Iblis. Und der
Vorläufer der oben erwähnten Sublimationen und Umwertungen von heute. Sie sind
Ausfaltungen geschichtlich gewordener Möglichkeiten, keine Konstrukte, keine
Projektionen, und es muss den Satan nicht als bocksfüßiges, rotes Männchen
geben, um ihn wirklich zu nennen.
Teufelslärm der freien Geister. Es schadet nie, in Erinnerung zu
rufen, was Nietzsche mit dem berühmten „Tod Gottes“ eigentlich gemeint hat.
Hier und bei anderen liegt die – zugeschriebene – Vorstellung einer
„Offenheit“, die die Moderne auszeichnete; nach welcher es also eine unbedingte
Wahrheit nicht mehr gebe.
Von der ersten Stelle,
dem Aphorismus „Der tolle Mensch“ in der Fröhlichen Wissenschaft, bis
zum Nachlassfragment Der Antichrist beklagt sich Nietzsche, dass man
sich der Schwere des Ereignisses, das freilich als Tat verstanden wird, nicht
bewusst ist. Alle festen Werte und Orientierungen sind vernichtet, und „irren
wir nicht durch ein unendliches Nichts?“ Klingt schlimm. Den Atheismus so
schwer zu nehmen, dass „Der Existenzialismus ein Humanismus“ wird, dass man mit
dem Tod Schach spielen kann, dass man in jenem Nichts eines bedrückenden
Schweigens baden kann wie in einem Becken gefüllt mit den Getränken sehr später
Abendstunden – das finden wir eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als
die Europäer Muße dafür hatten, die erstaunliche künstlerische Blüte eines
persönlich genommenen Christentums. Zuerst überwiegt jedoch das Gefühl einer
Befreiung, die manchmal in ihrer Unheimlichkeit gedacht wird (wie in
Hofmannsthals Chandos-Brief), aber jedenfalls schon bei Nietzsche als kreative
Kraftgestaltung. Womit die beiden Pole bezeichnet sind, zwischen welchen diese
Geschichte die Pracht ihrer Varianten entfaltet (und zwar vermutlich bis um
1970).
Ikea möbliert die Hölle. Was hat man aber daraus gemacht?
Die Moderne besaß die Offenheit als tiefes Leiden oder weite Hoffnung. Wir
besitzen die Rede von der Offenheit, die ihrerseits als unbezweifelbar gilt,
folglich nicht offen ist. So oft der moderne Zustand beschworen wird, so tief
ist er damit in Wahrheit überwunden. Man kann sich richten nach einem Wort des
französischen Romantikers Alfred de Musset: ce qui était nʼest plus, ce qui
sera nʼest pas encore. Die Modernen fühlten sich „dazwischen“, während „das,
was sein wird“ heute längst erreicht ist. Von der „Offenheit“ wird gesprochen,
nicht um das Dazwischen oder die Wunde offen zu halten, sondern um die „offene
Gesellschaft“ gegen ihre „Feinde“ zu verteidigen. Diese offene Gesellschaft,
die „liberale Demokratie“, der globale Kapitalismus oder welche Namen es für
den Status-quo noch geben mag – es soll an dieser Stelle nichts dagegen
eingewendet werden als seine Unfähigkeit, sich selbst zu denken. Der Status-quo
verwahrt sich gegen, etwa, Religion oder Nationalismus. Sie beanspruchen nicht
die falsche Wahrheit für sich (während man selbst die richtige hätte), nein,
ihr Fehler ist, „die eine Wahrheit“ zu behaupten – also nicht einmal, in erster
Linie, selbst ihr besonderer Eigentümer zu sein, sondern dass sie überhaupt
existiert. Das führt zur „geschlossenen Gesellschaft“. Der frühere Anspruch
(des 18. und 19. Jahrhunderts) alles Notwendige, d.h. auch moralische Gebote
und politische Formen, aus der Wissenschaft mit absoluter Gültigkeit
herzuleiten, war hier ehrlicher. Er war freilich nicht haltbar, und sicher ist
es diese Entdeckung der inneren Unheimlichkeit der Vernunft, die unser so
ausdauerndes Interesse an der Zeit um 1900 verursacht (nebst ästhetischen
Gründen, bessere und schlechtere). Ob man diese Zersetzung nun von Nietzsche
bezieht oder von seinen Pariser Aposteln der Sechziger und Siebziger Jahre, das
Resultat geht immer in Verneinungen aus (deswegen heißt alles post-sowieso; das
geht so weit, dass man heutzutage „die Post“ eigentlich umbenennen müsste, weil
unbegreiflich ist, wie unter einem solchen Namen etwas konkret Existierendes
verstanden werden kann). Wenn man nun jeden positiven Gedanken verneint, bleibt
zwar kein Gedanke übrig, aber darum noch lang nicht nichts. Sind doch die
Gedanken nicht alles. Übrig bleibt der Status-quo, der sich von selbst
fortschreibt. All die Tagessachen mit ihren raschen Erregungen und seichten
Passionen, die aber umso gnadenloser sich gegen die Mitmenschen wenden. Aber
auch die langfristigen Pläne, mit denen wir uns selbst und andere und die
Gesellschaft regieren, und deren innere Architektur uns mehr beschäftigt als
die Legitimität ihrer Zwecke.
Die Unmöglichkeit der
Philosophie ist das Gespenst der Freiheit. Was Freiheit heißt, indes, wandelt
auf schmalen Bahnen. Man darf denken, sagen, glauben, was man will, bloß unter
dem Vorbehalt, dass es nicht die Wahrheit ist, dass es ein Spiel ist, dass das
Schaukelpferd nie vom Fleck kommt. Jedes Spiel findet seine Grenzen daran, dass
es das Spiel der Spiele nicht stören darf: alles anzuzweifeln außer den Zweifel
selbst, keine Wahrheit anzuerkennen, außer dass es sie nicht gibt, nicht
unterstellen, dass das höchste Spiel keines ist. Das war mit der Offenheit
nicht gemeint.
Einspruch der illustren Toten. Und doch sind das alles falsche
Gerüchte, wie man auch anmerken darf. Foucault geht von der vollwertigen
Existenz auch des geschichtlich Kontingenten aus: es „währt“ hätte Heidegger
gesagt. Selbst Derrida will das „Phänomen“ zur Geltung bringen und „die
Vernunft“ weniger vernichten, als bloß ihr ihre absolut deduktive
Selbstgenügsamkeit rauben. Wer in allen Dingen, die ihm missfallen, ein
sogenanntes „Konstrukt“ sieht, womit die Idee seiner Fiktionalität verbunden
ist (auch das semantisch eigentlich abwegig), der hängt an einer falschen
Lesart dieser Autoren mit Zauberwortnamen (höflich ausgedrückt, denn
wahrscheinlich ist es einfach Hörensagen, das nicht davon wahrer wird, dass es
durch Universitäten geistert). Aber gerade wenn sich eine Zeitmeinung gegen
Vernunft und Erfahrung und gute Autoren durchsetzt, während sie mit vollendeter
Instinktsicherheit meint, dass all diese Quellen für sie sprechen, hat man die
interessanten Kulturtatsachen vor sich. Hört man in den geläufigen Reden von
Essentialismus und Konstrukt, was sie seinsgeschichtlich aussprechen, dann
sieht man den „umgedrehten Platonismus“, der, wie der eigentliche, allem, was
nicht ewig dauert, kein wahres Sein zuschreiben will; nur, dass man sich dessen
freuen soll.
Gestrandete Satanisten. Viel anders als scheinplural kann
eine Gesellschaft gar nicht sein: die Leut würden einander an die Gurgel gehen.
Deswegen haben Hobbes und Rousseau in ihren Systemen eine Art Wahrheit von
Staatswegen vorgesehen, die religion civil. Auch die „liberale Demokratie“ tut
mithin gut daran, sich um Einheit und Ordnung zu kümmern, aber ihr Bedürfnis,
einen Globus der happiness zu projizieren, sperrt ihre Einsicht in eine enge
Kammer.
Und damit muss wohl irgendwie
zusammenhängen, dass man „Subversion“ und „Transgression“ feiern kann, ohne an
die schiere Gefahr zu denken, die davon ausgehen könnte: die Ordnung, die nicht
so heißen darf, ist uns ja längst in alle Nerven und Muskeln gefahren, eine
Unfreiheit, die die Fähigkeit zum Bösen verloren hat. Transgressionen wie ein
Busch, der sich im Wind biegt.
Wenn wir gestrandete
Satanisten sind, dann weil unser relativistisches Denken nichts vermag, als von
sich selbst zu sprechen. Es sind die Dinge, die sich selbst regieren und uns,
und zwar genau in dem Maß, in dem wir sie für unser Produkt halten. Die
Subversion ist der Status-quo.


