Marit Heuß: verschlissenes idyll
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Matthias Schramm
Marit Heuß: verschlissenes idyll. Gedichte. Herausgegeben von Jayne-Ann
Igel, KdFS und Jan Kuhlbrodt. Leipzig (Poetenladen Verlag) 96 Seiten. 19,80
Euro.
Marit Heuß‘ Debütband „verschlissenes idyll“ beginnt mit einer sich
auflösenden Selbstverortung: „Ich bin ein Strichgerüst mit Gewicht aus
Träumen und / Enträumungen, ich bin ein Aug aus Marmorschlamm“,
heißt es im Eröffnungsgedicht, und wenige Zeilen später: „mein Gerüst aus
Händen setzt sich in Kräne fort“. Diese Zerlegung des Körpers in
seine Bestandteile, diese Durchlässigkeit zwischen Innen und Außen, zwischen
organischer Substanz und städtischem Material, erdet den gesamten Band. Hier möchte kein
stabiles Subjekt, das Landschaft betrachtet, leben. Es ist ein
Wahrnehmungsokular, das selbst aus den Stoffen besteht, die es registriert:
Asphalt, Hupen, Nachtigall und Kräne. Dass Heuß diese Selbstzerstreuung auch
phonetisch inszeniert, indem sie das Eröffnungsgedicht mit einer auffälligen Häufung von Ich-Lauten und Zischlauten
durchzieht, „Strichgerüst“, „Gewicht“, „ich bin ein Aug“, lässt das lyrische Ich
buchstäblich in seine Phoneme zerfallen, noch bevor es semantische Auflösung
erfährt.
Die sieben Zyklen des Bandes, von der eröffnenden „Stadtsternzone“ über
den titelgebenden Mittelteil bis zum abschließenden „Epitaph für Sebastian“, entfalten
eine Geländekunde, die geografisch präzise und gleichzeitig traumlogisch verfährt.
Lubmin, die Wissower Klinken, der Muldenfluss und Cospuden, Alt-Sternstadt oder
das Vogtland: Heuß registriert und kartiert ostdeutsche Landschaften, oder vom
Ostdeutschen auch gelöst, Landschaften, doch ihre Kartierung interessiert sich
weniger für Oberflächen als für das, was darunter liegt. In „Landschaft mit
Schächten“ heißt es: „Landschaft doch mit Schächten bei Alt-Sternstadt oder
wie, / liegt im Steinstaub der Jahre als dein ideales Werk“, und diese
Überlagerung von Erdgeschichte und Industriegeschichte, von geologischer Landschaft
und Formation und menschlicher Einschreibung, ist das eigentliche Thema des
Bandes.
Die Gedichte gehen dabei mit einer formalen Vielfalt vor, die ihrem Gegenstand
entspricht. Neben kürzeren, verdichteten Texten, die an Catull'sche nugae erinnern,
an jene scheinbar beiläufigen Kleinformen, die ihre Gegenstände gerade durch
die Geste der Verkleinerung adeln, stehen ausgreifende Prosagedichte, deren
Syntax sich vorwärts bewegt wie ein Bohrer, der immer tiefere Schichten
erschließt. In „Hundertlippiger Farn“ etwa akkumuliert Heuß Bestimmungen des
Farns: „Einfach überwachsen sein von Farn, faulendem Farn, / Farn,
tierisches, bestialisches Gewächs, das auch im Norden / groß wird, an
der gespenstischen Nordseite des Hauses“. Diese Akkumulation folgt einer eigentümlichen
Logik: Das Wort „Farn“ erscheint sechsmal, jedes Mal mit anderen Attributen
versehen, sodass eine Art botanische Litanei entsteht, die den Gegenstand nicht
festhält, diesen als Vexierbild aufbaut, das sich mit jeder Wiederholung neu
ausrichtet und orientiert. Es gleicht einer Auslotung. Der Farn wird zur
Chiffre für ein Wuchern, das sich nicht wirklich domestizieren lässt, und in
dieser Verweigerung, der Domestizierung, liegt die Poetik.
Denn das Verschlissene am Idyll, das der Titel ankündigt, meint nicht
einfach die Zerstörung einer ehemals intakten Natur durch industrielle
Ausbeutung, obwohl diese Dimension präsent ist. Es meint präziser die
Unmöglichkeit, Landschaft überhaupt als Idylle wahrzunehmen, die Einsicht, dass
jeder Blick auf Natur immer schon kontaminiert ist durch das Wissen um ihre
Durcharbeitung. In „Kurbad“ wird diese Kontamination zur Wellnesskur
umgedeutet:
„wir binden den Badegästen Grubenlampenan die Stirnen, schicken sie in Schächte,die neu geschichteten Erdteile zu durchglühen,schenken übermäßig Radonwasser ein,dass ihre Venen aufleuchten“
Das ist nun wahrlich keine Satire auf den Wellnesstourismus in
Bergbaufolgelandschaften, im Besonderen, wie mir scheint, eher Allegorie auf
das Sehen selbst. Die Grubenlampen, die hier an Stirnen gebunden werden,
invertieren das Bild des Bergmanns, der in die Tiefe steigt, um zu fördern, in
das des Kurgastes, der hinabgeschickt wird, um zu genesen, und in dieser
Verkehrung liegt eine bittere Pointe: Was einst Arbeit war, ist nun Erholung,
und was einst Ausbeutung gewesen ist, ist nun Therapie, doch die Schächte
bleiben dieselben. Das Radon, das die Badenden trinken bis ihre Venen
aufleuchten, ist dasselbe Radon, das als Zerfallsprodukt des Urans die
Bergleute der Wismut verstrahlt hat, und Heuß‘ Formulierung „übermäßig
einschenken“ trägt die Doppelbedeutung von Gastfreundschaft und Vergiftung in
sich. Die aufleuchtenden Venen sind ein Bild für eine Wahrnehmung, die das
Unsichtbare sichtbar macht, indem sie es inkorporiert: Der Körper als Entität
selbst wird zur Grubenlampe, die das Erbe der Tiefe an die Oberfläche bringt,
und dieses Leuchten, das zugleich Zeichen der Verseuchung und der Erkenntnis
ist, beschreibt die Poetik des Bandes genauer als jede andere literarische
Selbstauskunft.
Bemerkenswert ist, wie ich meine, wie Heuß ihre Zeitstrukturen handhabt. In „Fabrik“ wechselt das Gedicht zwischen Präteritum und Präsens: „Von der Fabrik hatte es geheißen, dass es in ihr gespukt habe“, beginnt der Text, und später „wohnte eine Schreckensfamilie“, doch dann, un-vermittelt: „ruhelose Stimmen gingen noch immer von dort aus, / geisterten in meinem Ort herum, hingen über dem / Kiesplatz“. Diese Transaktion markiert die Fabrik als einen Ort, der nie wirklich vergangen ist. Die Gespenster, die das Gedicht bevölkern, „Dracula selbst, der die Schar an-führte“, „Produktionsleiter, leichenblass“, „ungeheure Auto-maten“, sind nicht ausschließlich nur Metaphern für Erinnerung, sondern grammatisch präsente Wiedergänger, deren Zeitform ihre Unabgeschlossenheit bezeugt. Die Vergangenheit ist hier aber nicht abgeschlossen, die Vergan-genheit sickert ja ins Präsens ein wie das Radonwasser in die Venen der Badenden.
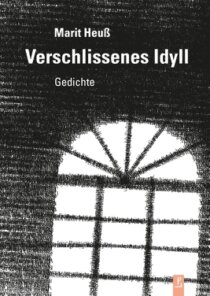
Neben dieser landschaftlichen Tiefenbohrungsbestrebung steht ein zweiter Strang, der in der bisherigen Rezeption weniger Beachtung fand: das Familiale, insbesondere das Mütterliche. Das Schlussgedicht „Momentaufnahme meiner Mutter“ rückt eine Figur ins Zentrum, die in den vorangehenden Texten nur am Rand erschienen war. „Morgenrot, das den Himmel färbt, / dreißig nach sechs, Hochsommer“, so beginnt das Gedicht, und dann, in einer anaphorischen Bewegung, die das gesamte Gedicht trägt:
„sicher steht Mutter jetzt auf,wärmt sich am Tee, am Hund,goldener Labrador, Fischotterkind,das die Mulde durchschwimmtsicher geht Mutter jetzt mit ihm,schmaläugig vor Müdigkeit,Hände in den Taschen“
Die Wiederholung des „sicher“ suggeriert zunächst Gewissheit,
doch bei genauerer Betrachtung verschiebt sich die Funktion des Wortes im
Verlauf des Textes unmerklich: Anfangs temporal und lokal gebraucht, wird es
gegen Ende epistemisch fragiler, die grammatische Gewissheit unterminiert sich
selbst, und was als Versicherung begann, entpuppt sich als Beschwörung gegen
das fehlende Wissen.
Dass Heuß die Mutter-Tochter-Beziehung des lyrischen Ichs ausgerechnet im
Material des Heus verankert, ist sicherlich mehr als nur eine ländliche Kulisse.
Das Gedicht entfaltet eine regelrechte Heu-Litanei:
„Heu, das wir mit Gabeln häufenHeu, das Mutter und ich mit Großvater wendeten,Heu, in das ich mich warf undHeu, das eine stundenlange wortlose Sache war,auch Heu, das sich beiläufig meinem Namen einschrieb“
Dieses Heu, das gewendet, gehäuft, bearbeitet wird, dessen Name im Nachnamen
der Autorin mitschwingt, wird zum Medium einer Beziehung, die sich nur über
gemeinsame Arbeit, über körperliche Kopräsenz in der Landschaft artikulieren
kann. Die Mutter erscheint anscheinend nicht als Gegenüber eines Gesprächs. Sie
ist die Figur in einem Tableau, das das lyrische Ich aus der Ferne betrachtet
oder imaginiert, und diese Distanz, die zugleich Zärtlichkeit und Ohnmacht ist,
gibt dem Gedicht seine eigentümliche, nahbare und nachfühlbare Temperatur.
Das Gedicht endet mit Kondensstreifen am Himmel, „Striche eines
Fortkommens, / das ihre Sache nicht ist“, und in diesem Schluss verdichtet
sich eine Haltung, die den gesamten Band durchzieht: ein Verharren, ein
Bleiben, ein Sichnichtfortbewegen, das sich zum rastlosen Fortschritt
der Moderne querstellt.
Die Mutter, die draußen steht und den Streifen nachsieht, wird zum Gegenbild
jener Mobilität, die die Landschaft durchzogen und kontaminiert hat, und
in dieser Verweigerung ruht die stillgelegte Würde.
Auch in „April, diesseits“ findet sich dieses Verharren,
verbunden mit einer Sehnsucht, die ins Archaische reicht: „Wir gehen hinaus
an den See, der Sand hat Farbe / und Körnung unsres Leuchtkerns“,
heißt es dort, und später: „wir halten wohl selbst die Sonne auf, / bannen
sie fest in ihrem Raum, / sind jenseits, sehen unsre Lippen / Saurier in Wolken
fressen, / bleiben jenseits des Spiegels dieser Welt“. Dieses Jenseits, das
kein religiöses ist, sondern ein Jenseits des Spiegels, ein Ort der
Vorstellung und der Verwandlung, durchzieht den Band als utopischer
Fluchtpunkt, an dem die unterschiedlichen Ebenen sich nicht mehr als
Last, aber eher als eine sehnsüchtige Tiefe erweisen.
Wie mir scheint, hat Heuß für diese Gedichte eine Sprache entwickelt und
verwirklicht, die gleichsam sinnlich konkret und semantisch überdeterminiert ist.
Wörter wie „Geblüt“, „Gestrüpp“, „Mulde“ tragen unterschiedlichste Kleider der
Identität mit sich, und die durchgehende Kleinschreibung am Versanfang, der
Verzicht auf Interpunktion am Zeilenende erzeugen für mich einen Lesefluss, der
die Grenzen zwischen den Sätzen kaschiert, sodass die Bedeutungen ineinander
übergehen wie die geologischen Scheinkrusten, von denen die Texte handeln. In
„Wissower Klinken“ wird diese Technik besonders schön sichtbar: „Hundert-ästige
Buchen an den Wissower Klinken halten aus / waagerecht überm Strand
krallen sich an Kreidefelsen“, und das Enjambement zwischen „halten aus“
und „waagerecht“ lässt das Aushalten selbst zur körperlichen Anstrengung
werden, zur horizontalen immerwährenden Spannung gegen das Abstürzen.
Dass Heuß promovierte Germanistin ist und unter anderem zu Kafka und Handke
gearbeitet hat, merkt man der Präzision ihrer Wortstellungen an, ohne dass die
Gedichte je akademisch wirkten. Die Intertexte, die sie einpflegt, von Rilke
über Emily Dickinson bis zu Jürgen Becker, funktionieren nicht als gelehrte
Verweise, vielmehr vibrieren diese mit dem Heuß‘schen Duktus. Das Motto von
Dickinson, das dem Zyklus „Schwesternsitz“ vorangestellt ist, „Twas awkward,
but it fitted me“, hallt nach in den vielen Szenen des Sicheinpassens, des
unbequemen Bewohnens von Orten und Körpern, die dieser Band entfaltet.
Der Leipziger Poetenladen hat dem Band eine Gestaltung gegeben, die seiner
Haltung entspricht: zurückgenommen, präzise, mit farbigen Zwischenseiten, die
die Zyklen voneinander trennen. Das Nachwort von Jan Kuhlbrodt ordnet die
Gedichte ein, ohne eine Erklärung oder einen Beipackzettel zu erzwingen, und
der Untertitel, den er seinem Text gibt, „Gegend, Gestalt, Geschichte“, benennt
die drei Koordinaten bzw. Variablen, zwischen denen sich die zeitgenössische
Lyrik bewegt.
Was nach der Lektüre bleibt, ist das Bild einer Dichterin, die genau
hinsieht und dabei weiß, dass das Hinsehen selbst eine Geschichte hat,
vermutlich die älteste industrielle Geschichte in Deutschland. Das
verschlissene Idyll ist nicht die zerstörte Landschaft; es ist der Blick, der
die Landschaft immer schon als Idyll sehen wollte und nun lernen muss, die
Nuancen unter der Oberfläche mitzulesen. „Rede mich aus, eingekapselt,
verhüllt im Faltenwurf der Küste“, heißt es in „Lubmin“, und dieser
Imperativ, der zugleich ein Sichausreden und ein Ausgeredetwerden meint,
beschreibt die Geste dieser Gedichte genau: Sie sprechen und denken die
Landschaft aus, indem sie ihre Verhüllungen abarbeiten, Schicht für Schicht,
bis das Verschlissene kein Makel mehr ist.


