Louis MacNeice: Unbelehrbar Mehrzahl
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Timo Brandt
“O leave me easy, leave me alone”
„Und Englands Landkarte war ein SpielzeugbasarUnd selbst Oberleitungen waren Musik“
Wer waren die wichtigsten/besten britischen Dichter (natürlich gab es auch wichtige und gute Dichterinnen, bspw. Edith Sitwell, Denise Levertov und die völlig zu Unrecht vergessene Mina Loy) der ersten Hälfe des 20. Jahrhunderts? Man wird sicher sehr unterschiedliche Listen finden, je nachdem, ob Tagore, Yeats und Eliot dazugezählt werden oder nicht (selten werden sich auch Philip Larkin und Thomas Hardy auf die Liste schleichen, John Betjeman wird allzu oft vergessen werden, Kipling leider allzu oft auftauchen). Aber in nahezu allen Fällen werden wohl (neben dem Außenseiter Dylan Thomas) die Namen W. H. Auden und Stephen Spender darauf stehen – und vermutlich auch dann und wann der Name Louis MacNeice.
MacNeice, geboren 1907 im britischen Nordteil von Irland, gehörte zwar wie Spender und Cecil Day-Lewis lose zu der so genannten „Auden Group“ und hat auch ansonsten einiges mit den linksorientierten Dichtern dieser Generation gemein, nimmt aber dennoch eine Sonderrolle ein. In seinem pfiffigen, aber manchmal auch etwas übereifrig-spitzfindigen Nachwort, in dem er unter anderem die Charaktere MacNeice und Auden vergleicht, versucht der Mitübersetzer Henry Holland aufzuzeigen, warum es von MacNeice (im Gegensatz zu Auden) bisher keine deutsche Übersetzungen gibt (und warum das zum Himmel stinkt) und auch ein bisschen, worin die Sonderrolle seiner Dichtung besteht.
„Clowns, Clowns undClownsTreiben Betrieb mitNutzen für NiemandSeppel von KönigGnaden und bewandertin falschem Rechnenund frohem Verfeuern“
Ich selbst bin vor Jahren, bei meiner Beschäftigung mit Auden, auf MacNeice gestoßen. Ich weiß noch, dass ich seine Lyrik als ungemein faszinierend, aber auch als sehr widerspenstig empfand – und unter widerspenstig stempelte ich sie dann erstmal ab. Diese erste größere deutschsprachige Übersetzung ausgewählter Gedichte durch Henry Holland & Jonis Hartmann gab mir nun die Chance, mein Urteil noch einmal ganz neu zu bilden.
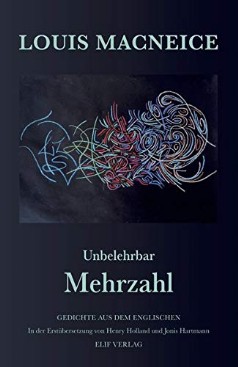
Eines hat sich nach der Lektüre nicht verändert: ich würde weiterhin sagen, dass Louis MacNeice, bei aller neuentfachten Begeisterung, ein sehr eigenwillige Dichter war. Damit meine ich nicht, dass sein Stil über die Maßen exzentrisch ist oder ich ihn eines falsch deklarierten Kult-Status verdächtigen will. Mehr geht es darum, dass er sehr unterschiedliche und mannigfaltige Formen verwendet hat und ebenso viele Poetiken zu verfolgen schien.
Vom „nursery rhyme“ bis zum komplex-analytischen Langpoem, von einer neuen Umsetzung (oder Auslegung) der Eklogen-Dichtung bis zum impressionistischen Zustandsgedicht, MacNeices Dichtung tritt in diversen Gestalten auf und, wie ich meine, auch mit unterschiedlichsten Ambitionen. Das alles ist selbstverständlich kein Fehler dieser Dichtung, es ist definitiv ein Feature.
Mir ist aber wichtig, dass die Leser*innen vorbereitet sind: MacNeices Dichtung hält viel Wundersames und Spannendes bereit, ist aber auch mitunter kryptisch und durchzogen von illustren, zynisch-frivolen, morbiden und witzigen Motiven und Tonlagen, die nicht immer leicht herauszuhören sind. Ich hatte oft das Gefühl, dass einige Seitenhiebe angebracht werden und nicht selten eine subtile bis brachiale Gesellschaftskritik in den Texten schwelt, dann wieder scheint sich MacNeice geradezu in seiner eigenen Perspektive zu verkapseln, ganz auf sich zurückgeworfen zu schreiben.
Es wäre schön gewesen, hätte Holland, statt sich so lange über die bisher fehlenden Übersetzungen (+ Hintergründe und Vermutungen) zu mokieren, in seinem Nachwort noch etwas mehr zu den einzelnen Gedichten, die ausgewählt wurden, gesagt. Ein Anmerkungsverzeichnis mit Hintergründen zu den Texten wäre auch nicht schlecht gewesen. Meiner Meinung nach ist MacNeices Lyrik keine, auf die man – besonders als Nicht-Muttersprachler, selbst mit Übersetzungen – einfach so losgelassen werden sollte. Damit will ich die Leistung der beiden Übersetzer ganz gewiss nicht schmälern, aber ich habe mich doch ab und an etwas verloren gefühlt.
„Wenn Bücher sich aufgegeben haben wie Bücher auf FriedhöfenUnd Lesen und sogar Sprechen ersetzt sind durchAndere, weniger schwierige, Medien, fragen wir uns, ob ihrIn Blumen und Früchten gleichen Geschmack und Farbe findet,Wie sie für uns hielten, für uns, in Worte gerahmt,Und wird euer Gras grün sein, euer Himmel blau,Oder werden eure Vögel immer flügellose Vögel sein?“
Kritik an Übersetzungen hat ja zumeist einen faden Beigeschmack. „Mach’s doch besser“, darf man als Übersetzer*in zurecht grummeln, wenn Kritiker*innen, die sich eben nicht jahrelang mit den Gedichten beschäftigt und die Möglichkeiten gewälzt haben, ihre Meinung zu den Übertragungen äußern; oft muss sich eine Übersetzung ja auch mit Mängeln an einigen Stellen abfinden, um dafür andere Qualitäten in der Übersetzung zu gewährleisten, und wer zählt dann die Mängel auf und übersieht die Qualitäten.
Ich möchte daher auch nur kurz auf die Übersetzungen eingehen und dazu die Anfangsstrophe aus dem (auch auf dem Rücken des Buches abgedruckten) Gedicht „Snow“ von MacNeice hier zweisprachig wiedergeben:
The room was suddenly rich and the great bay-window was
Spawning snow and pink roses against it
Soundlessly collateral and incompatible:
World is suddener than we fancy it.
Der Raum
war plötzlich reich und das große Erkerfenster
Laichte
Schnee und rosa Rosen dagegen
Lautlos
gegenseitig und unvereinbar:
Welt
ist plötzlicher als wir meinen.
Ich habe es schon oft erlebt, dass ich eine überraschende
Übersetzung beinahe automatisch als positiv eingestuft habe – wohl auch
deshalb, weil sie einfach neue poetische Funken generiert, anstatt die Flamme umständlich
vom einen zum anderen Feuer herüberzuretten. „Laichte“ ist natürlich eine coole
Übersetzung, aber ist sie auch adäquat? Vermutlich sind solche Fragen fast
unsinnig und in diesem Fall ist „laichte“ eine so präzis-unkonventionelle
Lösung, dass sie mir einleuchtet.
Was mir aber etwas aufstößt ist, dass dieses „spawning“ so
innovativ übersetzt wurde, man aber bspw. bei „rich“ eine wörtliche Übersetzung
vorlegt, die in meinen Augen nicht viel Sinn ergibt, vor allem aber im
Deutschen sehr holprig klingt, geradezu gestelzt; vielleicht ist es im englischen
Original genauso, das kann ich nicht beurteilen. Auch beim „suddener“ bin ich
mir nicht sicher, ob nicht etwas in Richtung „unmittelbarer“ oder dergleichen
besser gewesen wäre. Dieses Phänomen tritt in einigen Texten auf. Manchmal sind
Passagen auf besonders einfühlsame oder innovative Weise übersetzt, dann gibt
es Stellen, wo zu einer sehr wörtlichen Übersetzung gegriffen wird, die einfach
unsinnig wirkt (auf mich). Ein kleines Beispiel:
„Back for his holiday from across the water”
wird
übersetzt mit:
“In seinen Ferien zurück von übers Wasser”
Sehr begrüße ich dagegen, dass die beiden Übersetzer manche
englischen Begriffe unübersetzt gelassen haben (wobei mir hier wiederum
manchmal schmerzlich ein Anmerkungsverzeichnis mit Erläuterungen fehlt) und so
nicht die Eleganz oder die Lässigkeit von manchen Begriffen zerstören, die man
im Deutschen wohl schwerlich erreicht hätte. Auch gelingt es Hartmann und
Holland oft, den Swing/Takt von MacNeices Gedichten gut wiederzugeben, auch
wenn sie bei gewissen Texten auf Nachdichtungen verzichten.
Alles in allem ist das Abenteuer Louis MacNeice für
deutschsprachige Leser*innen nun möglich, und das ist gut so! Es war sicher
keine leichte Aufgabe, ihn überhaupt zu übersetzen und ich kann nur allen Dichtungsbegeisterten
mit etwas anglophilen Neigungen raten, sich das Ergebnis einmal anzuschauen. Sowohl
MacNeice als auch die beiden Übersetzer hätten es verdient.
Louis MacNeice: Unbelehrbar Mehrzahl. Englisch / Deutsch. Erstübersetzt
von Henry Holland und Jonis Hartmann. Nettetal (Elif Verlag) 2019. 187 Seiten.
16,00 Euro.


