Jörg Neugebauer: Es fehlen heilige Namen - zu Hölderlins Elegie "Heimkunft"
Memo/Essay > Memo
0
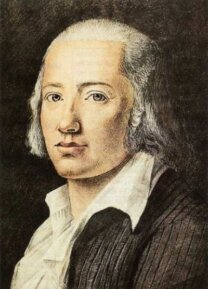
Jörg Neugebauer
Es fehlen heilige Namen - zu
Hölderlins Elegie "Heimkunft"
Heimkunft.
An die Verwandten.
Drinn in den Alpen ists noch helle
Nacht und die Wolke,
Freudiges dichtend,
sie deckt drinnen das gähnende Thal.
Dahin, dorthin toset und stürzt die
scherzende Bergluft,
Schroff durch Tannen
herab glänzet und schwindet ein Stral.
Langsam eilt es und kämpft das
freudigschauernde Chaos,
Jung an Gestalt,
doch stark, feiert es liebenden Streit
Unter den Felsen, es gähnt und wankt
in den ewigen Schranken,
Denn bacchantischer
zieht drinnen der Morgen herauf.
Denn es wächst unendlicher dort das
Jahr und die heilgen
Stunden, die Tage,
sie sind kühner geordnet, gemischt.
Dennoch merket die Zeit der
Gewittervogel, und zwischen
Bergen, hoch in der
Luft weilt er, und rufet den Tag.
Jezt auch wachet und schaut in der
Tiefe drinnen das Dörflein,
Furchtlos, Hohem
vertraut, unter den Gipfeln hinauf.
Wachstum ahnend, denn schon, wie
Blize, fallen die alten
Wasserquellen, der
Grund unter den stürzenden dampft,
Echo tönet unher und die unermeßliche
Werkstatt
Reget bei Tag und
Nacht, Gaben versendend, den Arm.
Ruhig glänzen indeß die silbernen
Höhen darüber,
Voll mit Rosen ist
schon droben der leuchtende Schnee.
Und noch höher hinauf wohnt über dem
Lichte der reine
Seelige Gott vom
Spiel heiliger Stralen erfreut.
Stille wohnt er allein, und hell
escheinet sein Antliz,
Der ätherische
scheint Leben zu geben geneigt,
Freude zu schaffen, mit uns, wie oft,
wenn, kundig des Maases,
Kundig der Athmenden
auch zögernd und schonend der Gott
Wohlgediegenes Glück den Städten und
Häusern, und milde
Regen, zu öffnen das
Land, brütende Wolken und euch,
Trauteste Lüfte dann, euch, sanfte
Frühlinge, sendet,
Und mit langsamer
Hand Traurige wieder erfreut,
Wenn er die Zeiten erneut der
Schöpferische, die stillen
Herzen der alternden
Menschen erfrischt und ergreift,
Und hinab in der Tiefe wirkt, und
öffnet und aufhellt,
Wie ers liebet und
jezt wieder ein Leben beginnt,
Anmuth blühet, wie einst, und
gegenwärtiger Geist kommt,
Und ein freudiger
Muth wieder die Fittige schwellt.
Vieles sprach ich zu ihm, denn, was
auch Dichtende sinnen
Oder singen, es gilt
meistens den Engeln und ihm;
Vieles bat ich, zulieb dem Vaterlande,
damit nicht
Ungebeten uns
plötzlich befiele der Geist;
Vieles für euch auch, die im
Vaterlande besorgt sind,
Denen der heilige
Dank lächelnd die Flüchtlinge bringt,
Theure Verwandte, für euch, indessen
wiegte der See mich,
Und der Ruderer saß
ruhig und lobte die Fahrt.
Weit in der Ebene wars Ein leuchtend
freudiges Wallen
Unter der Seegeln
und jezt blühet und hellet die Stadt
Dort in der Frühe sich auf, wohl her
von schattigen Alpen
Kommt geleitet und
ruht nun in dem Hafen das Schiff.
Warm ist das Ufer hier, und freundlich
offene Thale,
Schön von Pfaden
erhellt grünen und schimmern mich an.
Gärten stehen gesellt, und die
glänzende Knospe beginnt schon,
Und des Vogels
Gesang ladet den Wanderer ein.
Alles scheinet vertraut, der
vorübereilende Gruß auch
Scheint von
Freunden, es scheint jegliche Miene verwandt.
Freilich wohl! das Geburtsland ists,
der Boden der Heimath,
Was du suchest, es
ist nahe, begegnet dir schon.
Und umsonst nicht steht, wie ein Sohn
am Wellen umrauschten
Thor und siehet und
sucht liebende Namen für dich,
Mit Gesang ein wandernder Mann,
glückseeliges Lindau!
Eine der gastlichen
Pforten des Landes ist dies,
Reizend hinauszugehn in die
vielversprechende Ferne,
Dort, wo die Wunder
sind, dort, wo das göttliche Wild
Hoch in die Ebene herab der Rhein die
verwegene Bahn bricht,
Und aus den Felsen
hervor ziehet das jauchzende Thal,
Dort hinein, durchs helle Gebirg, nach
Komo zu wandern,
Oder hinab, wie der
Tag wandelt, den offenen See;
Aber reizender mir bist du, geweihete
Pforte,
Heimzugehn, wo
bekannt blühende Wege mir sind,
Dort zu besuchen das Land und die
schöne Thale des Nekars,
Und die Wälder, das
Grün heiliger Bäume, wo gern
Sich die Eiche gesellt mit stillen
Birken und Buchen,
Und in Hügeln ein
Ort freundlich gefangen mich nimmt.
Dort empfangen sie mich – o süsse
Stimme der Meinen!
O du triffest, du
regst langevergangenes auf!
Und doch sind sie es noch! noch blühet
die Sonn' und die Freud' euch,
O ihr Liebsten! und
fast heller im Auge, wie sonst.
Ja! das Alte noch ists! es gedeiht und
reifet, doch keines,
Wer da lebet und
liebt, lässet die Treue zurück.
Aber das Beste, der Fund, der unter
des heiligen Friedens
Bogen lieget, er ist
Jungen und Alten gespant.
Thörig red' ich. Es ist die Freude.
Doch morgen und künftig
Wenn wir gehen und
schaun draussen das lebende Feld
Unter den Blüthen des Baums, in den
Feiertagen des Frühlings
Red und hoff ich mit
euch vieles, ihr Lieben, davon.
Vieles hab ich gehört vom großen Vater
und habe
Lange geschwiegen
von ihm, welcher die wandernde Zeit
Droben in Höhen erfrischt und waltet
über Gebirgen,
Der gewähret uns
bald himmlische Gaben und ruft
Hellern Gesang und schikt viele gute
Geister – o säumt nicht,
Kommt, Erhaltenden
ihr! Engel des Jahres! und ihr,
Engel des Hauses, kommt! in die Adern
alle des Lebens,
Alle freuend
zugleich, theile das Himmlische sich!
Adle, verjünge! damit nichts
Menschlichgutes, damit nicht
Eine Stunde des Tags
ohne die Frohen und auch
Solche Freude, wie jezt, wenn Liebende
wieder sich finden,
Wie es gehört für
sie, schicklich geheiliget sei.
Wenn wir segnen das Mahl, wen darf ich
nennen, und wenn wir
Ruhn vom Leben des
Tags, saget, wie bring' ich den Dank?
Nenn' ich den Hohen dabei?
Unschikliches liebet ein Gott nicht,
Ihn zu fassen, ist
fast unsere Freude zu klein.
Schweigen müssen wir oft; es fehlen
heilige Namen,
Herzen schlagen,
doch bleibt die Rede zurük?
Aber ein Saitenspiel leiht jeder
Stunde die Töne,
Und erfreuet
vielleicht Himmlische, welche sich nahn.
Das bereitet und so ist auch beinahe
die Sorge
Schon befriediget,
die unter das Freudige kam.
Sorgen, wie diese, muß, gern oder
nicht, in der Seele
Tragen ein Sänger
und oft, aber die anderen nicht.
Während
Rilke inzwischen sogar in den Tagesthemen der ARD vorkommt, gilt Hölderlin
weiterhin als schwieriger Dichter. Kein Wunder, er pflegt einen hohen Ton, der
aufs erste eine gewisse Distanz erzeugt. Wenn man sich darauf einlässt und ihm
einfach zuhört, kommt einem das Gesagte aber auf einmal sehr nah. Es ist
Dichtung, die aus dem innersten Herzen spricht und, um sagbar zu sein, die
strenge Form, so wie hier das antike Versmaß der Elegie, und den hohen Ton
braucht, um zur Sprache kommen zu können. Die Alternative wäre nicht, das, was
gesagt werden soll, irgendwie simpler zu sagen, sondern es bliebe dann eben
ganz ungesagt, es wäre schlicht und einfach nicht da. Wobei der Autor,
Hölderlin, seinen eigenen Text nicht anders begreift als einen
"Gesang"; das innerste Herz bliebe verschlossen, gäbe es nicht die
Aussageweise der Poesie: Poetisch lässt sich sagen, was sonst unsagbar bliebe.
Was also
will der Autor in diesem sechsstrophigen Gedicht aus dem Jahr 1801 besingen?
Der Titel verrät es, gibt zumindest einen Hinweis: Es geht um eine
"Heimkunft", ein - in diesem Fall langsames - Heimkommen aus der
Fremde. Biografisch handelt es sich um die Heimreise - zu Fuß wohlgemerkt! -
aus dem kleinen Hauptwil, im Appenzellerland auf der Schweizer Seite des
Bodensees gelegen, 20 km von Konstanz entfernt. Und das Ziel des Wanderers ist
das heimatliche Nürtingen - jenseits der Schwäbischen Alb zwischen Stuttgart
und Tübingen.
Hölderlin
war in Hauptwil von Januar bis April als Hauslehrer tätig gewesen, sein
Engagement dort hatte ein rasches Ende gefunden. Die Gründe dafür kennen wir
nicht, es ist lediglich ein sehr positives Zeugnis seines Dienstherrn erhalten,
wahrscheinlich waren es Gründe, die mit Hölderlin gar nichts zu tun hatten. Zu
diesem Zeitpunkt ist er 31 Jahre alt und eigentlich immer noch ohne Beruf. Er
schlägt sich als Hauslehrer durch, will aber eigentlich nichts anderes sein als
ein Dichter. Gut, dass es in Nürtingen wenigstens noch die Mutter und auch die
Schwester gibt und ein eigenes Zimmer dort auf ihn wartet!
Von
alledem aber ist in dem Gedicht erstmal gar nicht die Rede, das er nach seiner
Rückkehr im Juni 1801 verfasst und das in mehreren Handschriften überliefert
ist.
In
Strophe 1 ist es früher Morgen, der Tag in den Alpen dämmert, der Dichter
beschreibt das als wilden Kampf der Elemente untereinander, die Schilderung
mutet an, als werde die Welt neu erschaffen an jedem einzelnen Morgen. Eine
Welt zunächst scheinbar noch ohne den Menschen, die schaffenden Naturgewalten
bleiben vorerst unter sich und bekämpfen einander in einem chaotischen
Schöpfungsprozess. Dann öffnet der Blick sich auf eine kleine menschliche
Siedlung.
In
Strophe 2 wird deutlich: bei alledem ist keine blindwütig schaffende
Naturgewalt am Werk, vielmehr ist das Ganze durchdrungen von einer
energetischen Kraft, die über den Elementen ebenso steht wie über dem Menschen.
Und diese greift auch unmittelbar ein - nicht nur als Quelle des Lebens in
allen materiellen Erscheinungen, sie schenkt auch die Freude und andere
Erregungen unseres Gemüts. Obwohl Hölderlin dafür die Formulierung
"Gott" verwendet, handelt es sich dabei nicht einfach um den christlichen
Gott der Bibel, dem Hölderlin skeptisch gegenüberstand - "Gott" ist
hier eher die Personifikation einer spirituellen Sphäre, ohne die die ganze
materielle Welt und ihre Erscheinungen sinn- und seelenlos wären.
In
Strophe 3 spricht erstmals in diesem Gedicht ein lyrisches Ich. Das Ich des
Wanderers, den es heimwärts zieht. Dieser lässt sich über den Bodensee
übersetzen und er ist in freudiger Stimmung - wie überhaupt das Wort Freude
ein Grundwort des ganzen Gedichts ist. Nirgendwo sonst finde ich die Empfindung
der Freude so subtil zugleich und intensiv gestaltet wie in diesem Gedicht -
zum Beispiel im Unterschied zu Schillers "Ode an die Freude", die
doch recht dick aufgetragen wirkt mit Formulierungen wie "Diesen Kuss der
ganzen Welt" usw.
Davon
ist Hölderlin, der in seinen frühen Jahren viel von Schiller gelernt und ihn
zeitweise geradezu nachgeahmt hat, in diesem Gedicht "Heimkunft", das
ja leider bereits in seine Spätzeit gehört, zum Glück sehr weit entfernt. Des weiteren
ist es der Dank, der diese Strophen durchweht, ein Gefühl der
Dankbarkeit, dies alles erleben zu dürfen, das sich verbindet mit Vorstellungen
weiterer Wanderungen, die in dem den See Überquerenden aufsteigen, während er
sich in seinem Boot allmählich dem Ufer nähert. Alles geschieht in Langsamkeit,
jeder Moment und jede Vorstellung ist wertvoll und mündet in die Vorfreude auf
die Landschaft der Heimat. Diese Überfahrt in Strophe 4 lässt ein Bild
entstehen wie auf einer Breitwandleinwand, ein Film, der große Ruhe ausstrahlt.
In den
beiden Schlussstrophen dann schließlich die Ankunft bei den Verwandten - denen
ja auch das ganze Gedicht gewidmet ist: Untertitel: "An die
Verwandten". Jetzt wird die Freude zum Überschwang. Doch es ist nicht nur
"einfache" Wiedersehensfreude, der heimkehrende Dichter sucht
zugleich nach Worten, die sein Empfinden ausdrücken können. Auf seiner
Wanderung hat er die Spiritualität erfahren, die sowohl der Natur innewohnt als
auch den engen Beziehungen zwischen den Menschen - den "Spirit", wie
wir Heutigen sagen. Davon möchte er seinen Lieben auch etwas mitteilen, aber er
weiß nicht recht, wie. Weil es schwierig ist, davon zu sprechen, es fehlen
einfach die Worte dafür. Darüber sich Gedanken zu machen und, so könnte man
hinzufügen, eine Sprache zu schaffen, die nicht stumm und hilflos bleibt, wenn
es gilt, spirituelle Erfahrungen mitzuteilen, ist Los und Aufgabe des Dichters:
Sorgen, wie diese, muß, gern oder nicht, in der SeeleTragen ein Sänger und oft, aber die anderen nicht.
Was
macht nun den - für mich - unwiderstehlichen Reiz dieser Verse aus? Hölderlin
verwendet, quasi nebenbei, außerordentlich kühne sprachliche Bilder, die so
vollkommen in den rhythmischen Duktus der Verse eingebettet sind, dass man aufs
erste fast drüber hinwegliest. Zum andern seine Spiritualität, die stets
angebunden ist an konkretes Erleben. Wenn er von "Gott" spricht, kann
es sich zum einen um eine örtliche Gottheit handeln, was - von Asien her
stammend - antikem Denken entspräche, dem Hölderlin zeitlebens nahestand. Das
heißt, dass einzelne Orte eine spezifische, an den jeweiligen Ort gebundene
Energie aufweisen. Zugleich ist zu bedenken, dass Hölderlin, wie auch aus
anderen Gedichten aus dieser Entstehungszeit hervorgeht, generell von einer dem
Materiellen übergeordneten geistig-spirituellen Sphäre ausgeht, die schwer bis
gar nicht eindeutig zu benennen ist. Wie es im Text heißt: "es fehlen
heilige Namen". Es ist offenkundig, dass er das nicht bloß irgendwie
theoretisch annimmt, sondern konkret gespürt und so empfunden hat - am eigenen
Leib sozusagen. Seine schon in früher Jugend zutage getretene sehr empfindsame
Konstitution mag ihn dazu befähigt haben, zu spüren und zu empfinden, was
andere, die meisten, ja beinahe alle anderen nicht spüren oder empfinden. Doch
das, man muss es nicht betonen, ist Segen und Fluch zugleich. Soviel kann man
jedoch sicher sagen: Wenn er von "Gott", "dem Göttlichen,
"den Himmlischen" und auch vom "Vater" spricht, hat er
dabei kein abstrakt-theologisches Konstrukt im Sinn, sondern etwas, das mit
seiner konkreten Erfahrung zu tun hat und das in diesen Formulierungen mehr
umschrieben als benannt wird. Eben deshalb, weil sie fehlen, die "heiligen
Namen".
Hölderlin
betrachtet es aber als Aufgabe des Dichters, diesem Mangel abzuhelfen, also
eine Sprache zu schaffen und zu verwenden, in der die spirituelle Dimension
unserer Welt in all ihren Erscheinungen greifbar und erkennbar wird. Als
Jüngling hat er das in Nachahmung Schillers mit der Verwendung abstrakter
Begriffe versucht. Das konnte nicht gutgehen, weil abstrakte Begriffe mit dem
lebendigen Leben weniger zu tun haben als wir oft annehmen. Später fand er dann
seine eigene unverwechselbare poetische Sprache, die sich bewusst von der
Alltagssprache abhebt, in dieser aber verwurzelt bleibt. Es ist dies eine
Synthese aus sprachlicher Nüchternheit und Begeisterung: Im poetischen Sprechen
beides zugleich zu sein - ganz bei sich und ganz außer sich, das ist das Ziel.
Eine Art Trunkenheit, mit höchster Klarheit verbunden - so kann Poesie
gelingen. In Hölderlins heute berühmtesten, zu seiner Zeit auf völliges
Unverständnis gestoßenes Gedicht "Hälfte des Lebens" finden wir es
ausgedrückt in den Versen
Und trunken von KüssenTunkt ihr das HauptIns heilignüchterne Wasser
Eine
Zeitlang, fünf Jahre vielleicht oder auch sechs, hielt Hölderlin diese Balance,
in "Heimkunft" kann man sie spüren. Heute vielleicht sogar besser als
damals, als zwar ab und zu eines oder mehrere seiner Gedichte in Anthologien
gedruckt wurden, insgesamt aber blieb das Echo doch sehr verhalten.
Vielleicht
auch deshalb, weil die damals literarisch tonangebenden Autoren, Goethe und
Schiller, mit Hölderlins Texten nicht viel anfangen konnten oder auch wollten:
Goethe erteilte ihm von oben herab ein paar Ratschläge nach dem Motto
"Fasse dich kurz", Schiller beantwortete seine Briefe irgendwann gar
nicht mehr. Das alles bedrückte Hölderlin als jemanden, der zeitlebens seine
Bestimmung als Dichter sah, der etwas bewegen will, und brachte seine auch
seelische Balance zunehmend ins Ungleichgewicht.
Johann
Christian Friedrich Hölderlin war ohne Vater aufgewachsen. Er ließ sich im
Tübinger Stift zum Theologen ausbilden, weigerte sich aber, Pfarrer zu werden,
und zog es vor, immer wieder als Hauslehrer tätig zu sein. In dieser
Eigenschaft machte er die Bekanntschaft der fast gleichaltrigen Frankfurter
Bankiersgattin Susette Gontard. In ihr fand er eine Seelenverwandte und
zugleich die Inkarnation der Diotima aus seinem Roman Hyperion, den er
kurz zuvor veröffentlicht hatte. Nach einer Auseinandersetzung mit Susettes
Ehemann verließ er das Haus Gontard und bezog ein Zimmer im nahegelegenen
Homburg zur Höhe. Heimlich trafen sich die beiden Liebenden alle paar Wochen,
auch wurden Briefe ausgetauscht. Schließlich verließ Hölderlin Homburg, um
woanders eine neue Hauslehrerstelle anzutreten. Die letzte führte ihn bis nach
Bordeaux, wo sein Engagement jedoch wie das in Hauptwil nur von kurzer Dauer
war. Die gesamte Strecke nach Bordeaux und wieder zurück legte er zu Fuß zurück
- den Hinweg mitten im Winter. Ein Freund überbrachte ihm nach seiner Rückkehr
die Nachricht, dass Susette Gontard in Frankfurt mit 33 Jahren gestorben war -
sie hatte sich bei einem ihrer Kinder mit einer Kinderkrankheit angesteckt.
Ein
Bekannter aus der Zeit in Homburg verschaffte ihm dort eine Stelle als
Hofbibliothekar, und so zog er wieder dorthin. Er hatte keine eigentlichen
dienstlichen Pflichten und widmete sich ausschließlich dem Schreiben. Dabei
verfasste er viel Neues, das oft unvollendet blieb, überarbeitete aber auch
bereits fertige und nach heutigen Maßstäben künstlerisch vollkommene und
teilweise bereits publizierte Gedichte. Diese zum Teil sehr langen Texte zu
überarbeiten, weil er mit ihnen inhaltlich und stellenweise auch sprachlich
nicht mehr einverstanden war, zehrte an Hölderlins Kräften. Seine psychische
Verfassung wurde derart bedenklich, dass er - gegen seinen Willen - nach
Tübingen in die psychiatrische Klinik am Neckar gebracht wurde. In dem Gebäude
ist heute die philosophische Fakultät untergebracht. Dort wurde er viele Monate
festgehalten und mit inzwischen als menschenunwürdig geltenden Methoden
behandelt.
Schließlich
entließ man ihn als unheilbar, und Hölderlin wurde Pflegling der
Handwerkerfamilie Zimmer, die im heutigen Hölderlinturm wohnte und dort ihre
Werkstatt hatte. Hier lebte er noch über 30 Jahre. Durch seine Publikationen
hatte er einen gewissen Ruf als Dichter, und da er als verrückt galt, stellte
er eine Art Attraktion dar. So erhielt er des öfteren Besuch. Auf Wunsch
verfertigte er gleich im Stehen zweistrophige Reimgedichte, die meist
Jahreszeiten zum Thema hatten. Sie hatten nichts mit seinem früheren Stil mehr
gemein. Meist unterzeichnete er sie mit dem Fantasienamen Scardanelli und schrieb
ein Fantasiedatum daneben. Als Herr Hölderlin angesprochen zu werden, verbat er
sich. Der Hyperion sowie einige seiner früheren Gedichte wurden immer
wieder nachgedruckt, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Erst im 20. Jahrhundert
begann man sich um die Originalmanuskripte zu bemühen, sie zu entziffern und
neu herauszugeben. Gleichzeitig damit wuchs auch das Ansehen Hölderlins als
Dichter. Heute gilt er als einer der größten Lyriker weltweit.
Es gibt
Menschen anderer Nationen, die die deutsche Sprache erlernen, nur um Hölderlin
im Original lesen zu können.


