Ann Cotten: Die Anleitungen der Vorfahren
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Samuel Meister
Ann Cotten: Die Anleitungen der Vorfahren.
Berlin (Suhrkamp Verlag) 2023. 160 Seiten. 18,00 Euro.
Trotzdem Heiterkeit – Zu Ann Cottens Die Anleitungen der
Vorfahren
Zuletzt ist es wieder einmal der Albatross.
Es sind Albatrosse, deren Eier von «eingeführten Nagetieren» am Kaʻena Point in Hawaiʻi aufgefressen werden (s.
139), es ist der Albatross, mit dem die Dichterin nicht recht weiter
weiß: «du kamst vielleicht auf die Welt, um ein Albatross zu sein, / aber du
weißt immer noch nicht, wie das geht» (s.142). Dieses poetische Wappentier scheint
also unausrottbarer als die Honigbiene, seit Baudelaire es ausgesetzt hat. Nun
gut, Ann Cotten weiß sich durch ein «vielleicht» zu helfen und durch
Unkenntnis: Nur vielleicht wurde sie ins Albatrossleben geboren, zudem fehlt
ihr das Know-how dazu. Diese Unsicherheit, wie man denn nun poetisieren, d.h.
leben könne, treibt die gattungslosen Anleitungen der Vorfahren vor sich
her. Zu Beginn und gegen Ende stehen vor allem Gedichte, dazwischen Notizen zu einem
Aufenthalt in Hawaiʻi. Dabei wird neu verhandelt, was in einen literarischen Text
gehört, worin literarische Sprache besteht, aus der Unkenntnis einer Dichterin
heraus, die alles kann und sich zum Glück alles erlauben darf.
„Eine
kurze Landung der Suika“ heißt das zweite, programmatische Gedicht, ein Gedicht
über ein Schiff, aber eigentlich über eine Technik:
Die Suika ist ein ausländerisches Schiff.Schiff heißt Technik.Sie ist ein Holzweg, a stub. Ein abweichender Strang. Einedeviante Fan-Fiction der Relativistischen Flotte.Die Suika ist nicht, sie fährt.Schrift ist ihr Kondensationsstreifen, Beschleunigung ihr Messgerät.Die Antriebsart ist Sehnsucht, Hoffnung der Treibstoff der Suika,nebst einer Art der Fortbewegung, die Gewärtigen genannt wird. (s. 10)
Die Landung der Suika scheint nicht nur
diesmal kurz zu sein, sondern grundsätzlich immer. Die Suika «ist nicht, sie
fährt»; eigentlich dürfte sie nie landen. Wobei «suika» auf japanisch
«Wassermelone» bedeutet, welche Cotten so ausweidet: «Wie die Melonenranke, die
auf dem Komposthaufen wächst und / mit dem Körper denkt und schreibt, /
schwellen wir gelegentlich voller Saft, ihr Messer!» (ss. 11–12). Manchmal,
offenbar un-vermittelt legt die Suika, schwillt die Melonenranke an. Als
Material dient gerne der sprachliche Abfall, der kompostierbar ist, aus dem
noch ein
süßer Kürbis wachsen kann. Ein Cottenscher Text möchte «abweichen», «Holzwege»
begehen (womöglich Heideggersche), sich wie Fan-Fiction vom poetischen
Hauptstrang absondern, «deviant». Wobei Suika u.a. auch der Titel einer «adult
visual novel» ist sowie eine Figur in der Manga-Serie Dr. Stone, die in
der Fachzeitschrift Dr. Stone Wiki wie folgt beschrieben wird: „Suika
initially was ostracized for her clumsiness and constant usage of a watermelon
helmet due to her nearsightedness etc.“. Weiter reicht mein Bildungs-hunger an
dieser Stelle nicht, aber das poetische Prinzip ist klar: Jede Wendung ist eine
Tischbombe, aus der die Anspielungen springen, man muss nur an der Lunte
zeuseln.
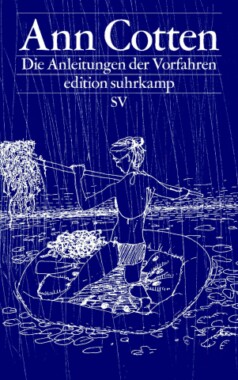
Das bürgerliche Feuerwerk (soweit ist das
Bürgertum gekommen) ist aber nicht der Zweck von Cottens Texten. Angetrieben
wird die Suika von «Sehnsucht» und «Hoffnung», daraus speist sich der Unwillen
anzulegen, das Verfahren der Absonderung vom Bekannten und des «Gewärtigens»
immer neuer Bilder. Wonach sehnt sich diese Poetik, worauf hofft sie? Im
allgemeinsten Sinn scheint sie auf die Befriedung der Welt abzuzielen:
Sprache ist so nice, weil sie so kalt ist,man hält die Wange daran und hört, wie es in der Tiefe spinnt:Alles, was an der Welt verwirrt ist, verzerrt ist, ist hier;wenn man anzieht, beginnt der Knoten zu glühen. (s.12)
In der Sprache spürt man die Verwirrung und
Verzerrung der Welt, man kann ihre Krankheiten diagnostizieren. Um das klarste
Beispiel herauszugreifen: Cotten verwendet «polnisches Gendering», etwa «sier»
anstelle von «sie» und/oder «er», um «Missstände aufzuzeigen» (Impressum). Die
Idee ist nicht die gängige, dass sich gewisse Missstände der Welt in der
Sprache zeigen, sondern dass es alle tun. Die Plausibilität dieser These
sei dahingestellt, aber jedenfalls impliziert sie einen hohen Anspruch an die
Literatur: Sie kann durch ihre Arbeit an der Sprache die Probleme der Welt erkennen
und damit zu ihrer Lösung beitragen, auch wenn die Lösung zuletzt «außerhalb
der Sprache» (Impressum) stattfinden muss.
Wenn die Tischbombe solche Ambitionen hegt,
erstaunt es kaum, dass in ihrem Kartontorso die philosophischen Binsen rascheln.
Immerhin scheint die literarische Rolle der Philosophie dieselbe zu sein wie diejenige
jeder sprachlichen Tätigkeit, nämlich kompostierbaren Müll für die Melonenranke
zu produzieren. Wie es am Ende der «Landung der Suika» in vollendetem Nonsense
heißt: «Opazität ist Konstanz, darin afforded die Kontinuität den Anteil / der
Transparenz» (s. 13). Die Notizen zu Hawaiʻi, die den Großteil des Buches ausmachen, sind dann ebenfalls
voll mit scheinphilosophischen Äußerungen, so voll, dass man auf den
schrecklichen Gedanken kommt, diese könnten doch für sich genommen ernst
gemeint sein. Zum Willen heißt es beispielsweise: „Muss man ihn nicht verwehen
lassen, wenn es einen Weg gibt und ja doch niemand fragt, ob sier den Weg gehen
will oder nicht? Verweht der Wille dann mithin wie eine wandernde Düne über die
Zufahrtsstraße? Sier ahnt, dass es Probleme geben wird“ (s. 78). Aber zuletzt
sollte man solche Stellen wohl ähnlich verstehen wie in Godards Filmen:
Philosophische Diskursfetzen werden nicht eingebaut, um im engeren Sinn
Philosophie zu betreiben, sondern um einen Teil der Grundstimmung einzufangen.
Diese
Grundstimmung ist in Hawaiʻi wie in der Poesie die Unsicherheit über die eigene
Stellung, nicht einfach allgemein der Welt gegenüber, sondern die kulturelle
Stellung einer Europäerin an der Schnittstelle zwischen Ost und West. Diese
Unsicherheit wird durch die Sicherheit, mit der sich das Gegenüber in der
scheinbaren Fremde bewegt, bis zur bodenlosen Ehrfurcht vor dem Göttlichen
verstärkt:
Ich war im Land der Göttennnisie fahren große Trucksmit riesigen Fahnenlauter Musiksanft und gefährlichund man will ihnen gefallenund man sieht, es ist unmöglichman sieht aus wie was man istein kleines Stück Kuchen (s. 146)
Ohne
die „Netzwerke der Vorfahren“ („Anleitungen“, s. 22), so sehr man sie verlassen
will, ohne die Tradition, der man ausgeliefert ist, so sehr man dies nicht
möchte, bleibt wenig als nur die Unsicherheit. Und so bekommt die (wirkliche
oder fiktive) Dichterin am Ende nur durch das wienerischste aller Mittel, um
Unsicherheit in Poesie umzuwandeln, wieder ihren Boden unter die Füße, durch
die ironische Selbstdegradierung zur Mehlspeise.
Was
bleibt? Offiziell der Anspruch an die Literatur, die Missstände der Welt in der
Sprache zu diagnostizieren, das Scheitern, einen selbstbewussten Standpunkt
gegenüber einer anderen Kultur einzunehmen – und die Verquickung der beiden
Aspekte, indem dieses Scheitern sich in der Schwierigkeit zeigt, die andere
Kultur sprachlich zu fassen. Aber jenseits dieser hehren Vorgaben bleibt
vielleicht etwas Bedeutenderes: die Heiterkeit des Sprachspiels trotz allem.


