Agnieszka Lessmann: Aga
Rezensionen/Lesetipp > Rezensionen, Besprechungen
Anke Glasmacher
Agnieszka Lessmann: Aga. Berlin (Gans Verlag) 2025. 242
Seiten. 24,00 Euro.
„Schaffen ist
Schöpfen, Erfinden ist Finden
, Gestaltung ist
Entdeckung.“ (Martin Buber)
Schweigen ist zeitlos
Warum Agnieszka Lessmanns Debütroman „Aga“ (Gans Verlag,
Berlin 2025) auch ein philosophischer Roman über unsere Moderne ist.
„Solang der
Himmel des Du über mir ausgespannt ist, kauern die Winde der Ursächlichkeit an
meinen Fersen, und der Wirbel des Verhängnisses gerinnt.“ (Martin Buber)
Kinder sind nicht sprachlos. Sie verstehen sich mit Gesten,
mit diesem Urvertrauen darauf, dass ihr Gegenüber neugierig ist und aufmerksam.
Als Aga Sara kennenlernt, haben sie keine gemeinsame Sprache. Aber sie haben
einen Draht zueinander, der keine Wörter braucht. Dieser Draht (oder: dieses
Garn) ist es, der Menschen beieinander und die Gesellschaft zusammenhält.
Aga ist gerade erst nach Deutschland gekommen und eigentlich
heißt sie auch gar nicht Aga. In Deutschland heißt sie Agnes. Ein Name, der
schützen soll. Aga hatte schon viele Namen, aber keine Zugehörigkeit. Agas
Entwurzelung hat Gründe, die sie als Kind nicht versteht. Ihre polnisch-jüdischen
Eltern haben den Holocaust überlebt, der Vater arbeitet nach dem Krieg in
seiner Heimatstadt Łódź als Journalist, doch als der Antisemitismus auch in
Polen immer lauter und aggressiver wird, beschließt er, mit seiner kleinen
Familie nach Israel auszuwandern. In Israel wird aus Aga Ilana. Ilana hat zwei
gute Freunde und Onkel Benno, den einzig weiteren Überlebenden der Familie. In
Israel bleiben sie nicht lange, der Vater will wieder als Journalist arbeiten, und
weil er deutsch spricht, beschließen sie, von Israel nach Deutschland zu gehen.
„Deutschland?“, bemerkt dazu Ilanas Kumpel Pawel: „Da sind die Mörder“.
„Die Wörter sind an die Dinge angeklebt, und die Namen an die Menschen. Den Dingen sind die Wörter egal, den Menschen nicht.“ („Aga“, S. 123)
In Polen heißt Aga Agnieszka, in Israel Ilana, für ihre
Eltern ist sie Aga, in Deutschland wird aus ihr Agnes und der erste Freund
nennt sie Aggi. So reist das Kind mit sieben Koffern nach Deutschland und wird
zukünftig fünf Namen im Gepäck haben. In Deutschland angekommen, lebt die
Familie zusammen mit einem Arztehepaar, zwei Opernsänger:innen, einem „Jäger“
und Saras Familie, die auf dem Dachboden untergekommen ist, in einem Haus der
jüdischen Gemeinde. Unter ihnen sind Überlebende der Konzentrationslager, des
Krieges, Partisanen, Widerstandskämpfer, aber das weiß Aga bei ihrem Einzug
alles noch nicht. Denn in dem Haus und hinter den Türen herrscht Schweigen über
die Toten, ein Schweigen, das ein Kind nicht versteht.
„Sie wuchern, die Geschichten, die man kleinen Kindern nicht erzählt.“ (S. 164)
Aga merkt früh, dass in den Geschichten, die sich die
Erwachsenen erzählen, etwas fehlt. Die Zeit. Oder eine Tochter. [Die Täterfamilien
erzählen keine Geschichten, sie erzählen gar nichts, sie schweigen noch nicht
einmal. Da fehlen Fotos in den Familienalben, als wenn die grauen Leerstellen
Abbild genug sind, da sind Brüder, Väter, Großväter und Onkel zusammenhanglos
irgendwo „gefallen“, da fehlen Berufe, fehlen Freund:innen, fehlt Alltag, fehlen
Zusammenhänge und in manchen Familien fehlen Menschen, die nicht gefallen
sind.]
Aber: „Das Schweigen ist ein mächtiger Zauberer.“,
sagt Aga.
Also machen sich Aga und Sara auf den Weg und suchen nach
dem Mörder; hat Pawel nicht gesagt, in Deutschland seien sie im Land der
Mörder? Aber der Kommissar, der Held der gleichnamigen TV-Serie, wird sie schon
finden, die Mörder. Und weil Namen nichts sind (und die Überlebenden auch
später noch Tarnnamen und eintätowierte Nummern tragen), erhalten die Menschen
und Orte Zuschreibungen. Da wird aus dem komischen Einzelgänger der Jäger, weil
er einen entsprechenden Hut trägt, Paul, der Gärtner, bringt es vom Zauberer zum
ersten Mordverdächtigen, weil er komische Löcher in den Garten hinter dem Haus
gräbt. Aber dann wird er doch zu Paul und nett ist er obendrein. Aga,
Protagonistin und zugleich die Ich-Erzählerin, spielt mit diesen Rollen, in die
sie selbst schlüpft. Sie ist der Kommissar. Sie wird den Mörder finden. Der
Mörder, so viel sei vorweggenommen, ist nicht der echte. Denn ein echter Mord
geschieht tatsächlich.
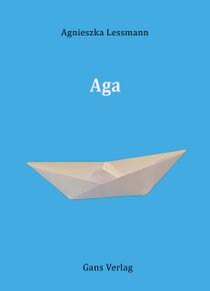
„Die Haltung des
Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er sprechen kann.
Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare. Das eine Grundwort
ist das Wortpaar Ich-Du. (...) Wer Du spricht, hat kein Etwas, hat nichts. Aber
er steht in der Beziehung.“ (Martin Buber)
„Was genau du wissen willst, habe ich zurückgefragt.“ Mit
dieser Aufforderung beginnt Agnieszka Lessmanns Geschichte über das Mädchen
„Aga“. Dieser Satz ist keine Frage, er ist eine Einladung. Eine Einladung,
Fragen zu stellen. Passiv zuhören und sich erzählen lassen, das geht bei diesem
Roman nicht, und das macht uns dieser erste Satz gleich klar. Die Rollen sind
umgekehrt, und ab jetzt ist Schweigen, das große Thema des Romans, keine Option
mehr. Theodor W. Adornos missverstehbare Aussage „(...) nach Auschwitz ein
Gedicht zu schreiben, ist barbarisch (...)“ kontert Agnieska Lessmann mit
dieser Rollenverschiebung. In ihrem ersten Satz stecken wie nebenbei die vier
Grundfragen von Immanuel Kant: „Was kann ich wissen?“, „Was soll ich tun?“, „Was
darf ich hoffen?“, „Was ist der Mensch?“ Am Ende der Erzählung werden wir uns
auf alle diese Fragen eine Antwort geben können.
„Aga“ ist eine Erzählung über Sprache. Eine Sprache für das
Schweigen und eine Sprache nach dem Schweigen. Das Schweigen nach der Shoa, ein
Schweigen, das wie ein schallisolierendes Filzvlies auf der nächsten Generation
liegt.
„Kann man Opfersein erben?“. Aga ist kein Opfer. Aber
sie ahnt früh, wer das Schweigen durchbrechen will, braucht Sprache, braucht
Wörter. Doch das Kind lernt erst einmal, dass (ihre) Sprache keine Übereinkunft
hat. Kein Name, kein Ort, keine Geschichte findet ihre Entsprechung in der
Wirklichkeit. Denn dafür müsste sie für etwas stehen. Doch in Agas Wirklichkeit
sind Namen, sind Begriffe lediglich Momentaufnahmen. Sie gelten nur an
bestimmten Orten. Und nicht jede:r verwendet sie für das gleiche. Nur: Durch
das Schweigen wird man nie verstehen, wie Geschichten zusammenpassen. Also
macht sich die Ich-Erzählerin auf den Weg, ihre Figuren, ihre Ichs und uns
mitzunehmen auf diese Reise, die keine Richtung kennt.
Agnieszka Lessmann hat mit ihrem Debütroman „Aga“ ein vielschichtiges
und vielstimmiges Werk vorgelegt. In der Genauigkeit, mit der sie die Sätze
komponiert, erkennt man die Lyrikerin, in den genauen Dialogen die Hörspielautorin
mit ihrem feinen Gespür für Wortwitz und Dramaturgie. Denn das ist dieses Buch
auch: spannend, humorvoll und leicht. Da ist keine überbordende Erzählstimme,
die uns ständig etwas erklären will. Wenn wir etwas verstehen wollen, müssen
wir uns selbst auf den Weg machen. Agnieszka Lessmann liebt ihre Figuren und
alle gleich. Jeder schenkt und belässt sie ihre eigene Sprache. Das ist hohe
Kunst.
„Das ist der
ewige Ursprung der Kunst, daß einem Menschen Gestalt gegenübertritt und durch
ihn Werk werden will.“ (Martin Buber)
Kunst lebt von (in?) seinem Gegenüber. Allein deswegen ist
die in unserer Zeit so gleichsam überstrapazierte wie oft genug fehlinterpretierte
Kategorie „autofiktional“ für diesen Roman obsolet, auch wenn Agnieszka
Lessmann ihre Ich-Erzählerin von ihrer Familiengeschichte sprechen lässt. Wir
müssen uns nicht auf die Suche nach der „wahren Geschichte“ machen. Wir
brauchen keinen Abgleich. Denn diese Geschichte spielt in uns, in jedem/jeder
einzelnen von uns. Wenn wir den Mut haben, Fragen zu stellen, und die Geduld,
die ganze Geschichte zu erfahren. Schweigen ist zeitlos.
Agnieszka Lessmann ringt nicht nur nach Worten, nach einer Sprache.
Sie hat mit „Aga“ einen Roman (natürlich passt die Kategorie nicht) vorgelegt,
der in unsere Zeit gehört, gerade weil er vom Schweigen (und vom Sprechen) handelt.
Ein Schweigen, das uns ganz neu umgibt, ein Schweigen, das besonders dröhnend
wird, seit wir wieder damit begonnen haben, auf allen Kanälen aufeinander einzubrüllen.
Zur Autorin: Agnieszka Lessmann, geb. 1964 in Łódź,
Polen, wuchs in Polen, Israel und Deutschland auf und lebt heute in Bensberg.
Sie studierte Germanistik, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft und
Italianistik in Köln und arbeitete schon während des Studiums als Hörspiel- und
Feature-Autorin und Kulturjournalistin für verschiedene Rundfunkanstalten und
Tageszeitungen. Für ihre Texte erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, aktuell
das Autorenstipendium des Deutschen Literaturfonds 2025.
mehr unter: https://agnieszkalessmann.de
Literatur:
Martin Buber, „Ich und Du“, Reclam 1995
Theodor W. Adorno, „Kulturkritik und Gesellschaft“, Suhrkamp
1977


